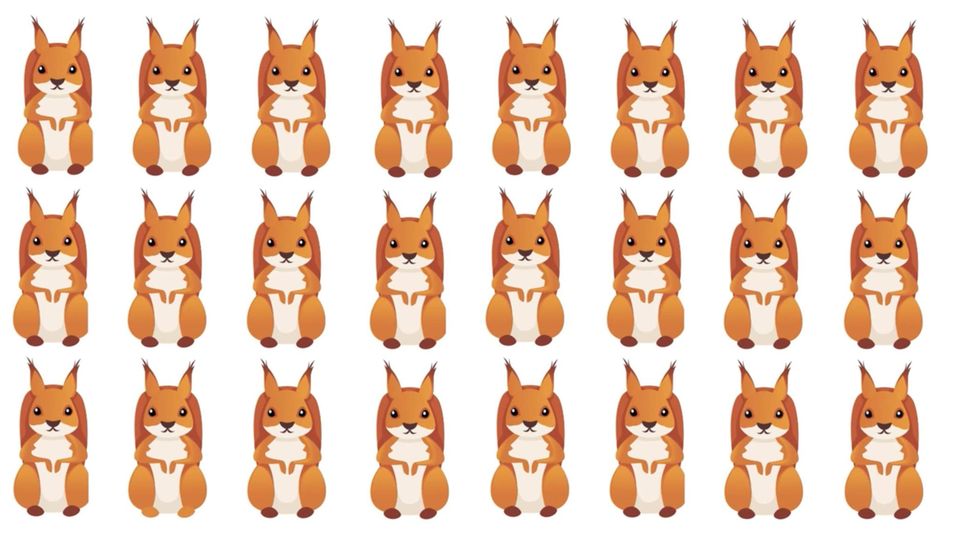Sand hasse ich, Kies hasse ich, und am meisten hasse ich Steine. Steine sind wirklich die unnützeste Ausdrucksform der Natur, das merkt man schon daran, dass sie einfach immer nur herumliegen. Ich hasse das schlammige Wasser, das mir in die Gummistiefel läuft und meine besockten Zehen umspült. Ich hasse die Sonne, die mir meinen Nacken langsam aber stetig verbrennt. Ich hasse meinen Rücken, der schmerzt, weil ich seit zwei Stunden vorgebeugt Sand, Kies und Steine in einer Schüssel wasche, um das zu finden, was ich will. Ich stehe in einem Gebirgsbach in Norditalien und suche nach Gold.
Dieses wunderschöne Edelmetall, mindestens fünf Milliarden Jahre alt, geboren, als ein Riesenstern bei einer Supernova explodierte und die nukleare Hitze aus Elementarteilchen Goldpartikel backte, die dann mit Millionen Stundenkilometern durchs All schossen. Ein Teil davon blieb in der Staubwolke hängen, die später unseren Planeten formte und wurde dann von der Erdkruste für eine Ewigkeit vergraben. Bis die Alpen sich auffalteten und noch viel später ihre Gletscher schmolzen und das Gold aus dem Bergmassiv lösten, hinab in das Tal trugen, durch die Wälder, in die Flüsse. Bis es in einer blauen Plastikschüssel landet, gehalten von einem Typen mit Sonnenbrille, Sonnenbrand und Anglerhut, der in Gummistiefeln und nassen Socken im Wasser steht.
Fünf Milliarden Jahre gereist zu mir, mein Gold
Ich durchwühle den schwarzen Sand am Boden der Schüssel, und da liegt es: Gold. Ein winziges Körnchen nur, geformt wie ein Herz. Weltraumgold, Alpengold, fünf Milliarden Jahre gereist zu mir, mein Gold. Ich starre es an wie ein Besoffener einen Döner um vier Uhr nachts auf dem Kiez. Ich reibe über die raue Oberfläche und halte es fest zwischen meinen Fingerspitzen in die Sonne. Es glänzt nicht, echtes Naturgold glänzt nie. Es ist sich selbst genug, es muss gar nicht glänzen. Ich möchte dem Goldkörnchen nah sein, ich will, dass es mich liebt. Und ich will mehr davon.
Goldfieber macht süchtig wie eine Droge, vielleicht schlimmer
Arturo Ramella hatte mich gewarnt, als wir am Vorabend in einer Pizzeria saßen und mir der Büffelmozzarella auf die Tischdecke tropfte. Er sagte, dass sich das Goldfieber nicht beschreiben lasse. Ich müsse das fühlen, wenn nach einer langen Suche am Boden der Pfanne eine Flocke pures Gold klebe. Es mache süchtig wie eine Droge, vielleicht sogar schlimmer. Dabei sei es in kleinen Mengen ja gar nichts wert, höchstens ein paar Euro. Aber um Geld ginge es dabei nicht, das würde ich schon noch lernen.
Arturo Ramella ist 55 Jahre alt und der Vorsitzende des Goldsucher-Vereins in Biella, einer norditalienischen Provinz nahe der Alpen im Piemont. Schon vor mehr als 2000 Jahren schlachteten die Römer dort die einheimischen Stämme ab, um das Alpen-Gold in Ruhe am Flussufer zu schürfen. Damit finanzierten sie Söldner und Waffen, um die Iberische Halbinsel zu erobern. Sie gruben, nun ja, sie ließen graben, so lang, bis fast jeder Stein am Flussrand umgesetzt war und das Gold auch noch ihre Helme und Paläste zierte. Ramella hat mit ein paar Freunden in den Achtzigern angefangen, wieder an den Ufern nach Gold zu suchen. Er verbringt fast jedes Wochenende am Fluss, er genieße das, die Natur, die Sonne und natürlich das Gold.
Arturo Ramella trägt ein feines Slimfit-Hemd, das Haar zurückgeföhnt und seine Fingernägel penibel gestutzt, ohne eine Spur von Flussdreck. Schon wie er das Wort Gold ausspricht, fasziniert mich. "Oooro", sagt er mit seiner tiefen, rauchigen Stimme, das O etwas langgezogen. Ein Klang, der Abenteuer verheißt, Reichtum und eine Wahrheit, die nur kennt, wer reines Gold erblickt.
"Ich möchte einen Tesla"
Als der Abenteuerjournalist Helge Timmerberg in Brasilien nach Gold suchte, campte er im Dschungel mit anarchistischen Goldgräbern, Menschen, die ihre Gier auf niederste Instinkte reduziert hatte. Die mit Revolvern aufeinander ballerten, Koka-Blätter mampften und sich gegen Jaguare verteidigten. Ich habe heute zum Frühstück ein Cornetto Crema gegessen und frisch gemahlenen Espresso getrunken. Dann bin ich in meinen schneeweißen Audi-A3-Mietwagen gestiegen und habe ihn direkt am Flussufer geparkt. Dort zog ich mir Gummistiefel an, die ein wenig eng waren. Aber das war es auch schon mit den Unannehmlichkeiten der Goldsuche in Italien. Während Fotograf Marcus und ich auf Arturo Ramella warten, planen wir, was wir von dem Gold kaufen werden. Marcus sagt: "Ich möchte einen Tesla, da muss ich gar nicht lange überlegen." Ich sage, dass ich um die Welt reisen möchte. Und noch einen Tesla dazu.
Signor Ramella, das geföhnte Haar nun mit einer Kappe bedeckt, das edle Hemd gegen ein robustes aus Baumwolle getauscht, zeigt mir, an welchen Stellen des Flussufers ich mit dem Spaten graben muss. Dort, wo die Steine vom Wasser abgeschliffen wurden, sagt er, dahinter sammle sich das Gold, wenn der Bach über die Ufer tritt. Weil es schwerer ist als fast jedes andere Element, sinkt es im seichten Wasser auf den Boden. Ramella hievt drei, vier Schaufeln in meine Plastikschüssel, die als Goldpfanne dient. Wir stellen uns gummistiefeltief in den Fluss, er krempelt seine Hemdsärmel hoch und rüttelt unter Wasser an der Schüssel, damit sich die leichten von den schweren Materialien trennen. Dann spült er zärtlich die obere Schicht aus der Schüssel. Am Ende bleibt nur der schwarze, eisenhaltige Sand. Und darin liegen drei Körner Gold. Ich lasse vor Freude beinahe die Schüssel fallen.
200 Körner ergeben ein Gramm Gold
Arturo Ramella beruhigt mich. Etwa 200 dieser Körner ergäben ein Gramm Gold. Und erst ein ganzes Gramm brächte etwa 33 Euro ein. Die drei Körner reichen also nicht mal für einen Duftbaum im Tesla. "Der Fluss ist kein Geldautomat", sagt Ramella. Er hat in seinem Leben vielleicht 100 Gramm Gold gefunden, schätzt er, und das meiste davon wurde vor ein paar Jahren von Einbrechern geklaut. Ist ja auch ziemlich clever, beim Vorsitzenden der Goldsucher-Vereinigung einzubrechen, denke ich, sage ihm das aber nicht.
Die Ägypter nannten Gold das Licht der Sonne – kein Stück zu kitschig
Ich schaue mir das Stück Gold genauer an, das ich gefunden habe. Das Körnchen hat eine perfekte Ästhetik mit seiner kantigen Oberfläche, eine perfekte Farbe, die man eben nur mit dem Adjektiv golden beschreiben kann. Eine Farbe, die in der Natur einzigartig ist und bloß bei Gold vorkommt. Nur afrikanische Sonnenuntergänge und Zigaretten mit ihrer glutroten Krone haben eine ähnliche Ästhetik wie Gold. Die Ägypter nannten es das Licht der Sonne, und diese Metapher ist kein Stück zu kitschig.
Dabei ist der Wert von Gold vom Menschen erfunden, genau wie der von Papiergeld. Ein Wert, der nur durch die Begrenztheit von Gold existiert. Je rarer, desto teurer. Aber auch die Schönheit des Goldes ergreift jeden, der es betrachtet. Deswegen fingen Menschen vor 6000 Jahren an, daraus Schmuck zu basteln. Deswegen verließen Hunderttausende im 19. Jahrhundert ihre Heimat, um in Kalifornien in dunkle Minenschächte zu kriechen oder in Kanada den Klondike River zu durchwühlen. Deswegen überfiel der Rapper Xatar einen Goldtransporter, wurde zu acht Jahren Gefängnis verurteilt und hat einfach nicht verraten, wo er seine Beute versteckte.
Wie ein Wahnsinniger schaufele ich nun Erde in meine Plastikschüssel, wasche sie im Fluss aus, ziehe die kleinen Goldstücke behutsam aus dem Dreck, fluche, wenn die Schüssel leer ist. Das Fieber hat mich ergriffen. Auch als Wolken aufziehen und der Donner in der Ferne grollt, mache ich weiter. Ich liebe das Gold so sehr, ich möchte es schmelzen und mir in die Vene spritzen und mein Herz panisch pochen spüren, wie es sich langsam am Metall vergiftet.
"Wollen wir nicht lieber eine Pause machen und ein Panino essen?", fragt Ramella. "Noch eine Schüssel", sage ich ohne ihn anzuschauen. Nach der dritten Schüssel, als die ersten Regentropfen fallen, legt er mir die Hand auf die schwitzige Schulter: "Lass uns nun wirklich ein Panino essen. Morgen ist auch noch ein Tag."
"Gold nimmt manchmal mehr, als es gibt"
Als wir im Auto sitzen und über die Landstraße fahren, erzählt er, dass er neben seinem Job als Wander-Guide auch Kurse anbietet, bei denen Teilnehmer die Goldsuche erlernen. Etwa 100 Leute aus ganz Europa kämen jedes Jahr nach Biella, um hier im Fluss zu suchen. Erdkundelehrer aus der Schweiz, junge Pärchen, die sich daraus einen Ehering schmieden wollen, oder Rentner, die sich nach einer Stunde Goldsuche mit einer Flasche Weißwein in den Schatten legen. Als Vorsitzender der "World Goldpanning Association" richtet Ramella jährlich eine Weltmeisterschaft aus, bei der die Teilnehmer so schnell wie möglich zwölf Goldstücke aus einem Eimer voll Schutt und Sand waschen müssen. Ja, es gibt wirklich für alles eine Weltmeisterschaft, denke ich.
Er selbst sei dreifacher italienischer Meister, erzählt Signore Ramella. Ich wisse ja jetzt, wie sich das Goldfieber anfühlt. Und dann sagt er sehr ernst: "Gold nimmt manchmal mehr, als es gibt." Ich frage ihn, was er damit meint. Nun, sagt er, Familie, Freunde, Zeit, Geld, man müsse aufpassen, dass man das Leben abseits des Flusses nicht vergesse. Ich frage, wie seine Frau mit seinem Hobby umgeht. "Ich bin geschieden", antwortet er. "Deine Frau mochte das Gold also nicht?" – "Nein", sagt Arturo und blickt auf seine Hände. Ich frage nicht weiter nach.
Als wir uns verabschieden, gibt mir Ramella eine CD. Das Lied darauf solle ich mir unbedingt anhören. Ein italienischer Sänger hat es für die vergangene Weltmeisterschaft geschrieben, und er finde den Text ganz nett, also ziemlich passend, also, was das Fieber betrifft. Ich höre mir die CD an, im Refrain singt er: "Du suchst Gold im Fluss, aber du findest es in dir." Und dann: "Überlasse deine Seele dem Strom."
"Du suchst Gold im Fluss, aber du findest es in dir"
Am nächsten Morgen fahre ich mit Marcus zurück zum Fluss. Signor Ramella führt eine Wandergruppe durch die Alpen. Wir sind allein. Weil Marcus gestern Bilder machen musste, ist er jetzt heiß darauf, selbst nach Gold zu suchen. Er legt die Kamera ab und beginnt, den Ufersand umzugraben. Wir finden: nichts. Nur eine einzige Goldflocke verirrt sich in meine Plastikschüssel. Nach der Sucht kommt der Entzug. Das Wasser plätschert gegen den Uferrand, und die Vögel singen, als würden sie uns eine komische Oper widmen.
Ich starre in meine leere Schüssel und denke mir, dass Arturo Ramella wie ein Dealer ist, der einem die erste Dosis schenkt, weil er genau weiß, wie süchtig der Stoff macht. Vielleicht hat er sogar am Vortag Gold im Ufersand verbuddelt, damit wir es finden. Schließlich war er es, der uns sagte, wo wir graben sollten. Will er, dass wir einen Kurs bei ihm buchen? Verdient man am Goldrausch am besten, indem man Schaufeln verkauft, so wie Mark Twain es einst sagte? Ich glaube, ich hatte zu viel Sonne.
Während Marcus weitergräbt, setze ich mich auf einen Stein, kühle die schmerzenden Füße im Wasser und blicke auf die Alpen, die sich am Horizont in die Höhe strecken. Die Schönheit, die Ewigkeit des Bergmassivs überwältigt mich. Vielleicht sind Steine doch ganz okay, zumindest in Form von Bergen. Ich betrachte das Goldstück, das ich gerade gefunden habe. Ich überlege kurz, dann lasse ich die Flocke in den Fluss fallen, das Wasser trägt sie davon. Ich summe das Goldgräber-Lied: "Du suchst Gold im Fluss, aber du findest es in dir, überlasse deine Seele dem Strom." Marcus steht im schlammigen Wasser und flucht, als er den gesiebten Dreck zurückschleudert: "Ich will einen fucking Tesla!"
Diese Geschichte stammt aus der vierten Ausgabe von JWD – Joko Winterscheidts Druckerzeugnis. Zu kaufen auch hier.